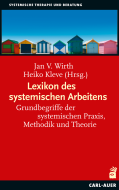Einsamkeit

engl. loneliness, franz. isolement m, solitude f; bezeichnet eine Form der unerwünschten → Exklusion aus sozialen Systemen (→ Sozialsystem) und ist zu verstehen als schließlich umfassendes Wegbrechen von → Kommunikation, mit fühlbaren Folgen für Betroffene und deren Lebenssituation. Die Kommunikation von Einsamkeit als Beschreibung ihrer Gegenwart bezeichnet indes einen performativen Widerspruch. Denn Kommunikation als Mitteilungsverhalten setzt → Kopplung, → Beziehung, → Sinn, also Kommunikation, voraus – in welcher Form und in welchen Medien auch immer. Einsamkeit als → Systemzustand bedeutet zuletzt, jeglicher sozialer Bindung, sozialer Zugehörigkeit, sozialen Kontakten und Möglichkeiten der Teilhabe an Kommunikation verlustig gegangen zu sein.
Systemtheoretisch wird Einsamkeit als Systemzustand nur kommunikationsförmig erschließbar. Von außen ist dieser nicht einsehbar. Denn es gilt, dass die → Umwelt ein Negativkorrelat des Systems sei, also alles andere sei als das System (Luhmann 1984), auch in entgegengesetzter Richtung, sodass das System ein Negativkorrelat der Umwelt sei, also alles andere sei als seine Umwelt. Einsamkeit als Ergebnis der Koproduktion eines biopsychischen Systemzusammenhangs (Bewusstsein eines Gefühls) lässt sich sozial nur im Nachtrag, in der rekonstruktiven → Konstruktion thematisieren – als Unterscheiden und Bezeichnen mittels Kommunikation (als soziales System).
Selbstgespräche als Emulation (= Nachahmung) von Kommunikation oder lautem Denken können Folgen von Einsamkeit sein, sind aber nicht mit ihr selbst oder sozialen Systemen zu verwechseln. Ein Selbstgespräch ist kein soziales System. Es virtualisiert Zuhörerschaft, zu der man auch selbst gehören kann, und kontrolliert so sprachlich die psychische Fortzeugung seiner Gedanken. Bei Kindern lässt sich oft beobachten, dass sie ihr Spielverhalten mit fiktiven Gesprächen kommentieren. In Form von Selbstinstruktionen (»Jeder Fehler ist ein Schritt zum Erfolg«) haben sich Selbstgespräche in Lernsettings, → Beratung und → Therapie bewährt (z. B. Metzig u. Schuster 2003, S. 175 ff.).
Selbstverständlich kann aber über Einsamkeit kommuniziert werden. Es wäre also zu unterscheiden einerseits zwischen Einsamkeit als Systemzustand, der als Gefühl psychische Systeme informiert, und andererseits zwischen Einsamkeit als Inhalt von Kommunikation, der als Beschreibung oder Bewertung die Fortsetzungsbedingungen sozialer Systeme mit beeinflusst. Das hindert niemanden, sich im Alleinsein oder in Gemeinschaft einsam zu fühlen. Wissenschaftstheoretisch ist das ein nicht unwichtiger Punkt: Was können wir wissen über Phänomene wie Einsamkeit (und → Suizidalität, aber auch Glück), die sich ja nicht empirisch beobachten, sondern nur auf andere Weise, z. B. über das Medium Kommunikation, erschließen lassen?
Systemkonstruktivistisch (→ Konstruktivismus) ging es darum, die Grenzen des Erkennens zu erkennen. Erstens entstehen in Kommunikation, → Interaktionen oder Bewusstseine keine Abbildungen einer extern gegebenen real existierenden Umwelt. Individuen (→ Individuum), → Gruppen, → Organisationen und schließlich die Weltgesellschaft entwerfen aktiv entlang ihrer eigenen variationsreich gewordenen Erkenntnisformen Modelle und Bilder ihrer pluralen Wirklichkeiten. Zweitens folgt aus der ersten Annahme die Feststellung, dass soziale Systeme über keine Mittel verfügen, in objektiver und eindeutiger Weise auf eine externe, wie auch immer geformte gegenständliche Umwelt zuzugreifen und mit den eigenen Wirklichkeitskonstruktionen abzugleichen.
Die Frage ist also demnach nicht, ob es Einsamkeit gibt, weil es sie nicht »gibt« als eine Art kosmischer Selbstverständlichkeit, was jenseits von Beobachtern, die so und nicht anders beobachten, untersucht werden kann. Vielmehr ginge es darum, wie sie in den jeweiligen kommunikativen Lebenswirklichkeiten der Adressaten und Adressatinnen konstruiert, richtiger gesagt: rekonstruiert wird.
Und wie es entlang des lebenspraktischen Wissens um die → Kontextabhängigkeit des menschlichen Empfindens richtig ist, dass die Einsamkeit des jungen unfreiwillig sexuell abstinent lebenden Mannes nicht dieselbe sein kann wie die Einsamkeit der zu früh Witwe gewordenen Mutter im Pflegeheim oder die der Corona-Patienten und -Patientinnen an den Beatmungsgeräten in der hermetisch abgeriegelten Intensivstation, ist es insbesondere systemisch wichtig, die zeitlichen Kontexte (→ Zeit) und deren Bewältigungssemantiken zu berücksichtigen. Es ginge zudem stets darum, die sachlichen und sozialen Kontexte von → Lebensführung mitzuberücksichtigen, in dem es zum Sich-Ereignen von Einsamkeit gekommen ist.
Für das systemisch konzipierte Arbeiten bleibt im Zugriff auf die Unterscheidung von Selbstexklusion (autonom gewählter Selbstausschluss) und Fremdexklusion (umweltbedingter Ausschluss) wichtig, dass diese vermeintlichen »Exklusionstatbestände« auf Komplexitätsreduktion und kommunikativen Zurechnung beruhen. Ob jemand, um am Beispiel zu bleiben, über Exklusion und Einsamkeit selbst verfügt, sich also dazu autonom entschieden hat, ist keine Frage der Handlung als solche, sondern der behutsam und wertschätzend geführten Kommunikation darüber, wer überhaupt wie gehandelt hat oder hätte handeln können vor dem Hintergrund einer Vielzahl von unterschiedlichen und zumeist nicht vorhersehbaren Ereignissen.
Daraus folgt unter anderem, dass seitens der professionellen Kräfte die Fähigkeiten zu trainieren und die Kompetenz dafür zu steigern wäre, mit → Komplexität und mit dem daraus folgenden → Nichtwissen konstruktiv umzugehen. Es ginge darum, feine, aber folgenreiche Unterschiede zu bemerken bzw. zu kommunizieren, die sodann unterschiedliche Perspektiven auf Wirklichkeit und Möglichkeit nach sich ziehen können.
Entscheidend ist jedoch, gewissermaßen als Gegenkraft des zur Einsamkeit schwingenden und dort verharrenden Pendels der Lebensführung, schlicht die Kraft der Gemeinsamkeit zu identifizieren, wieder zu erzeugen und auf neue Weise nützlich zu machen. Dieses Gemeinsame wird nicht nur gestiftet von der Kommunikation selbst, die sich als das Gemeinsame im Hier und Jetzt ja gerade beginnt auszudifferenzieren. Sie wird insbesondere geformt durch gemeinsame Themen, Interessen, Bedürfnisse und nicht zuletzt von Alternativen, die Menschen in ihrer biopsychosozialen Verfasstheit unabhängig von ihrer geographischen, kulturellen (→ Kultur) oder sozialen Herkunft miteinander teilen und in Beziehung bringen.
Systemisches Arbeiten als Arbeit am Gemeinsamen könnte mit seinen Adressatinnen und Adressaten und/oder unter Fachkräften zu Kommunikationen anstiften, die
• die Einsamkeit als Schicksal oder gar finalen Endzustand aus kommunikativen Zonen ihrer Unbeobachtbarkeit, Ignoranz, Verächtlichmachung, Tabuisierung und des Verschweigens hervorholen
• Einsamkeit nicht als gegeben vorfindbar, sondern als Teil einer eigenaktiv und in Ko-Konstruktion gemeinsam erzeugten Wirklichkeit begreifen
• Einsamkeit nicht voreilig bewerten, sondern als vorübergehende Problemlösung würdigen, die zu gegebener Zeit und im Gegensatz zur Gemeinsamkeit ihren Nutzen aufs Neue zu erweisen hat
• den doppelten, ja zwiespältigen und nur deswegen sinnförmigen Blick auf Wirklichkeit (Lebenswirklichkeit) und Möglichkeit (Lebensentwurf) neu entdecken und einüben
• Unterschiede in den Perspektiven und Positionen auf Einsamkeit zum probeweisen Stiften von mehr Gemeinsamkeit nützlich machen
• Zurechnungen in den Blick nehmen und damit einhergehende Wertsetzungen behutsam, aber konstruktiv-kritisch hinterfragen
• den Fokus auf die – wie auch immer medial-digital vermittelt – wirklichen Zugangsmöglichkeiten und → Ressourcen der verschiedenen Teilsysteme und → Netzwerke richten
• sowie die eigenen blinden, familiären bzw. biografischen Flecke und Umgangsweisen mit Einsamkeit ausloten und reflektieren
• damit verbundene Exklusionen, aber auch als Verursachungskontexte erscheinende Inklusionsformen und -übergänge kritisch erkunden
• sowie schließlich und generell die anfangs vielleicht nur wenig aufscheinenden Handlungsmöglichkeiten der Adressaten und Adressatinnen in ihrer möglichst verbundenen Lebensführung zu steigern, ohne diese voreilig zu überfordern, und nicht zuletzt
• die Kommunikation über Kommunikation als mittlerweile fachlich unabdingbare Erfordernis von professionsförmiger Kommunikation (nicht nur über Einsamkeit) begreifen.
Das Gegensatzpaar von Einsamkeit und Gemeinsamkeit steht wie ein Syndrom für die → Ambivalenz und das kommunikative Wechselspiel heutiger stark individualistischer Lebensführung, die für ihre Individuen sowohl erhebliche Handlungsspielräume wie auch -begrenzungen erzeugt.
Wenn es um die systemische Erweiterung dieser Handlungsspielräume geht, arbeiten wir vorzugsweise nicht mit Menschen (das wäre anthropologisches Arbeiten) oder sogar an diesen (das wäre psychologisches Arbeiten). Denn es sind eben nicht »Menschen« oder ihre »Es«, sondern von Sinnsystemen als Ambivalenz erlebte Unterscheidungen (Gefühle und Gedanken), die Veränderung motivieren und artikulieren. Erst nämlich durch die Ambivalenz von Perspektiven und die Mehrdeutigkeit von Kategorien, die zudem auch andere und anders sein könnten, entstehen kommunikative und gedankliche Räume, in denen ein unterschiedlicher Umgang mit Einsamkeit (und Gemeinsamkeit) ausprobiert werden kann.
Als mögliches Ziel der Arbeit mit und an Einsamkeit stellt sich kontraintuitiv also nicht ihre Aufhebung in Gemeinsamkeit oder gar Geselligkeit als erneut deindividualisierendes Selbstaufheben von Betroffenen dar. Vielmehr geht es um das kommunikative Bewahren der in der Einsamkeit von Moment zu Moment sich einebnenden Ambivalenz von Wirklichkeit und Möglichkeit bzw. um das gemeinsame Erkunden ihres in dieser Diskrepanz fortlaufend entstehenden Sinns.
Verwendete Literatur
Kieserling, André (1999): Kommunikation unter Anwesenden. Studien über Interaktionssysteme. Frankfurt a. M. (Suhrkamp).
Luhmann, Niklas (1980): Gesellschaftsstruktur und Semantik. Frankfurt a. M. (Suhrkamp).
Metzig, Werner u. Martin Schuster (2003): Lernen zu lernen: Lernstrategien wirkungsvoll einsetzen. Heidelberg (Springer).
Weiterführende Literatur
Wirth, Jan V. u. Heiko Kleve (2020): Von der gespaltenen zur verbundenen Lebensführung. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht).