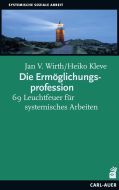Das starke Herz der Wirtschaft
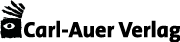
Familienunternehmertum als Garant für Freiheit, Wohlstand und Nachhaltigkeit
Der deutsche Mittelstand, zumindest der unternehmerisch aktive Teil, ist ausgesprochen stark vom Familienunternehmertum geprägt. 90 Prozent aller Unternehmen, die kleinen, mittleren wie großen, sind in Familienhand. Dies könnte als geringe Mobilität des Produktionskapitals beklagt werden, ist doch das Kernmerkmal dieser Unternehmensform die Transgenerationalität, also die Weitergabe des Unternehmenseigentum von einer an die nächste Familiengeneration. Wer nur die Seite der Konzentration des Kapitals in den Händen von Unternehmerfamilien kritisiert, übersieht die ökonomischen und sozio-moralischen Effekte, die das Familienunternehmertum für eine stabile wie ausgeglichene liberal-demokratische Gesellschaft hat.
In ökonomischer Hinsicht können wir Familienunternehmen als besonders nachhaltig bewerten. Die Familieneigentümer/innen intendieren, das Unternehmen für die nächsten Generationen zu erhalten, wollen ihr unternehmerisches Engagement an ihre Kinder und Enkel weitergeben. Dies setzt voraus, dass sie nicht auf schnelle Gewinnausschüttungen setzen, sondern den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg und damit den Erhalt ihres Unternehmens im Blick haben. Besonders in Deutschland und Japan können wir beeindruckend alte Familienunternehmen bestaunen, die mehrere Jahrhunderte auf dem Buckel haben sowie eine ausgewogene Verbindung aus familiärer Tradition ihres Unternehmertums und innovativer Marktorientierung realisieren.
Ein weiteres wirtschaftliches Erfolgsrezept des Familienunternehmertums liegt in den zumeist bescheidenen Gewinnerwartungen der Familiengesellschafter/innen, die nicht so sehr die schnelle Steigerung ihres Reichtums anstreben, sondern die solide finanzielle Ausstattung ihres Unternehmens. Daher belassen sie einen Großteil des Gewinns im Unternehmen, um dessen Liquidität, insbesondere für Investitionen und strategische Opportunitäten, sicherzustellen. Das große Interesse von Familiengesellschaftern am Erhalt des Unternehmens geht überdies damit einher, dass hier Eigentum, Kontrolle und Verantwortung zusammenfallen. Genau deshalb können die unternehmensbezogenen Entscheidungen von Familiengesellschaftern als tendenziell risiko-aversiv bewertet werden. Denn diese Eigentümer/innen müssen sich die Verantwortung für ihre Entscheidungen voll zurechnen lassen, von denen sie bestenfalls profitieren, dessen Effekte aber auch finanzielle und familiäre Belastungen zeitigen könnten.
Familienunternehmer/innen, als eine den Mittelstand besonders prägende Gruppe, sind nicht nur wirtschaftlich bescheiden, sondern könnten zugleich – im moralischen Sinne – als „gute“ Kapitalisten bewertet werden. Während Familienunternehmensfamilien unternehmerisch agieren, wirtschaftlichen Erfolg über Generationen anstreben und bestenfalls auch erreichen, sind Unternehmen in Familienhand familiäre Unternehmen. Damit ist gemeint, dass diese Firmen das, was gemeinhin Familien ausmacht, und zwar die ausgeprägte Personen- statt Funktions- und Rollenorientierung, langfristige Loyalität statt kurzfristige Nutzenmaximierung, regionale Gebundenheit statt örtlicher Mobilität, ebenfalls präferieren und ausbilden. Diese Familiarität von Wirtschaftsunternehmen hat zahlreiche sozio-moralische Effekte: Familienunternehmer zeigen ein starkes Interesse für das Wohlergehen ihres Personals und fühlen sich für die Region ihres Unternehmenssitzes mitverantwortlich, investieren in örtliche Infrastrukturen und engagieren sich bürgerschaftlich.
Selbst in großen Familienunternehmen, die auf dem Weltmarkt agieren und kaum noch als Familienbetriebe erkennbar sind, offenbaren sich diese wirtschaftlichen und sozio-moralischen Effekte, und zwar auch dann, wenn kein Familienmitglied mehr im Unternehmen tätig ist, sondern ausschließlich über Gesellschafterrollen das Unternehmen kontrolliert wird. Ebenso in solchen Unternehmen zeigen die Gesellschafter/innen nicht nur ökonomische Interessen am Unternehmenseigentum, sondern wollen, dass ihr Eigentum über ihre eigene Familie hinaus nutzenbringend ist. Diesen Eigentümern geht es nicht selten um sinnstiftendes Tun, so dass sie mit großem Eifer gesamtgesellschaftliche Modernisierungen, wie etwa die ökologisch nachhaltige Transformation der Weltwirtschaft, mit voranzubringen versuchen.
Speziell die Tatsache, dass Menschen in Familien aufwachsen, in denen sie Unternehmenseigentum erhalten, wofür sie nicht selbst gearbeitet haben, versetzt sie in eine psychologische Haltung der umgekehrten Reziprozität: Während Menschen normalerweise zuerst arbeiten müssen, bevor sie die Früchte ihrer Arbeit als Ausgleich für ihre Arbeitsleistung genießen können, ist es in transgenerationalen Familienunternehmen umgekehrt: Die Gesellschafter/innen erhalten Unternehmenseigentum, für das sie bisher noch nichts getan haben. Dies versetzt sie in einen solchen privilegierten Zustand, der zu einem interessanten Phänomen führen kann, dass sie nämlich durch ihre persönlichen, unternehmerischen und sozialen Aktivitäten sich selbst und anderen zeigen wollen, dass sie dieses Eigentum auch „verdient“ haben. Daher sind Familiengesellschafter:innen oft nicht nur im eigenen Unternehmen engagiert, sondern auch darüber hinaus, in der zivilen Bürgergesellschaft.
Alles in allem lebt eine liberale und demokratische Gesellschaft, die mithin sowohl individuelle Freiheitsrechte als auch politische Mitgestaltung des Gemeinwesens und der sozialen Systeme nicht nur ermöglicht, sondern für ihre Existenz benötigt, vom privaten Unternehmertum. Und dieses Unternehmertum etabliert diese Ordnung stark stützende Pfeiler, wenn es sich nicht nur individuell ausprägt, sondern familiär, als enkelfähiger, auf die nachfolgenden Generationen ausgerichteter wirtschaftlicher Erfolg. Dann können Gemeinschaft wie Gesellschaft davon profitieren.