Der eine Höcke und der andere Höcke
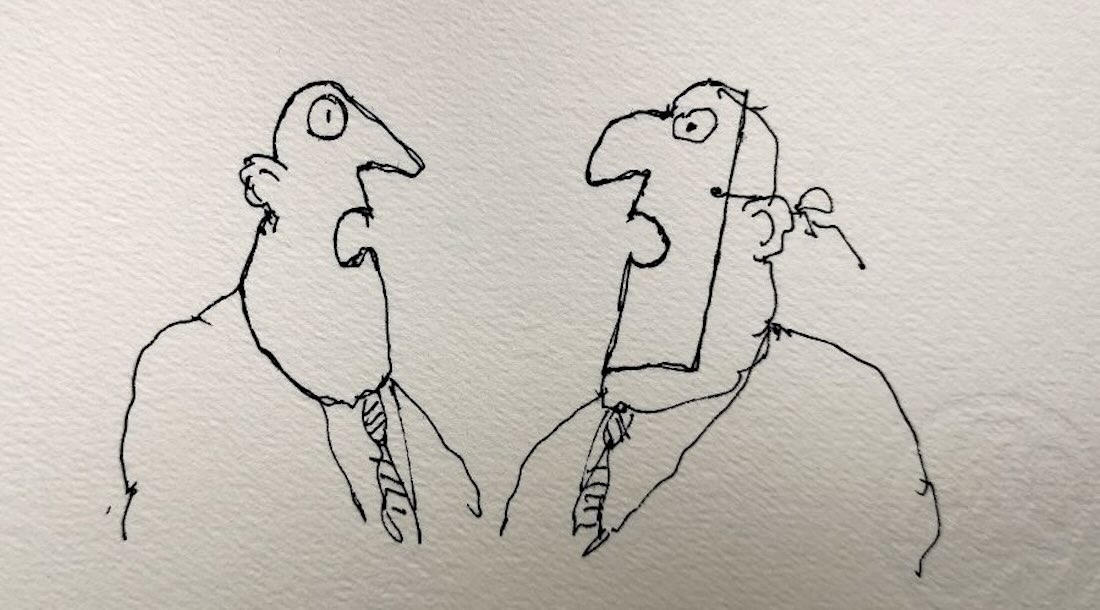
Das Höcke-Voigt-TV-Duell war kein richtiges Duell. Es war ein Höcke-Höcke-Duell
Es sollte eins der spektakulärsten TV-Ereignisse vor den anstehenden drei Landtagswahlen werden. Kaum war das TV-Duell zwischen Höcke und Voigt beendet, wetteiferte man hoch erregt im Kreis der (zumeist journalistischen) Experten darüber, wer denn wohl gesiegt hätte. Wie hätten sich die beiden Kontrahenten geschlagen? Wer hätte besser argumentiert und was würde der nun folgende Faktencheck bringen? Um die jeweiligen Expertenpositionen dann in altbekannter „Sowohl-als-auch-Harmonie“ zu glätten. Der Eine habe ein wenig gesiegt und der Andere auch ein wenig. (Ich erinnere mich dabei an ähnliche Gespräche nach den meisten TV-Duellen der letzten 22 Jahre.)
Im Netz brachte man sich gleich nach dem Gongschlag der letzten Duell-Runde in Stellung, um der Welt lautstark DIE Wahrheit über das TV-Duell zu verkünden. In Stellung gehen hieß, den eigenen Favoriten (wen wunderts) überschwänglich zu feiern. Vor Ort tat man dies im Voigt-Lager vor laufender Kamera. Das Höcke-Lager zog die Intimität hinter verschlossenen Türen vor.
TV-Duell: Demokratie gegen Rechtsextremismus
So wie ich es sonst gerne tue, habe ich weniger auf die politischen Aussagen, die Korrektheit der Fakten oder die Plausibilität von politischen Ankündigungen oder gar politischen Versprechungen geachtet. Vielmehr interessierte mich zu sehen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Beiden den kommunikativen Raum (non-)verbal füllten. Dabei achtete ich primär nicht z.B. auf körpersprachliche Details, die man immer im speziellen Kontext sehen muss. Stattdessen interessierten mich typische Verhaltens- und Wirkungsmuster der beiden Politiker. Solche Muster können deutlich unter Stress beobachtet werden. Diese Muster sind nur sehr bedingt kontrollierbar und zeigen, wie jemand unter Stress beinah automatisch reagiert. Funktion und Arrangement des TV-Duells waren in diesem Fall Stress genug, einerseits. Andererseits fand das TV-Duell in einer extrem aufgeheizten gesellschaftspolitischen Stimmungslage in Deutschland statt, nämlich als Duell zwischen Demokratie und Rechtsextremismus statt.
Um es gleich auf den Punkt zu bringen: ich war daran interessiert zu sehen, ob, und wenn ja wie, sich typische Verhaltens- und Wirkungsmuster in Höckes Auftritt erkennen lassen könnten. Könnten solche Muster doch Einblicke in die Art und Weise geben, wie Rechtsextreme in der Öffentlichkeit kommunizieren, um Menschen für ihre Art der Politik zu begeistern. Zu begeistern ist was anderes als politisch zu überzeugen. Zu begeistern meint die emotional verführerische Ansprache statt durch politische Inhalte persönlich zu überzeugen.
Daher werde ich in meinem Beitrag kaum auf den CDU-Politiker eingehen.
Zwischen Hemmung und Unterbrechung
Höckes Reaktions- und Verhaltensmuster, so wie sie im TV-Duell sichtbar wurden, sind primär durch eine deutliche Spannung zwischen sichtbarer Hemmung, emotionaler Zurücknahme und Kontaktabbruch einerseits gekennzeichnet. Andererseits durch fast schon erratisch-impulsiv wirkende Heftigkeit im Auftritt, die eher dann aus ihm rausbricht, wenn er sich, in die enge gedrängt fühlend, angegriffen erlebt. Dann hat er sich nicht mehr unter Kontrolle. Dann wirkt er zügellos. So unterbricht er vehement die Moderatoren und Voigt. Höcke ist nicht darin geübt (nicht gewillt?) Unterbrechung als Form der politischen Debatte zu praktizieren. Diese ist nämlich Teil politischer Auseinandersetzung und unterliegt, sozusagen in unausgesprochener Übereinkunft der Beteiligten, gewissen Gepflogenheiten. Man unterbricht, der andere redet weiter, beide reden für einen Moment gleichzeitig, bis schließlich der Eine oder Andere wieder die Möglichkeit hat auszureden. Voigt hat dies, wenn er Höcke unterbrach, so gemacht. Höcke hingegen wandelte, so könnte man sagen, seine Unterbrechung steigernd in eine zügellose Attacke. Dabei wirkte er gelegentlich nicht nur zügellos, sondern auch gar außer sich. Er wurde lauter, missachtete sein Gegenüber, indem er heftig gestikulierend, nach vorne gebeugt wie in Angriffsstellung mit seinen ausgestreckten Armen in die Luft schlug.
So als würde es darum gehen: „ich bin, wenn Du nicht bist“.
Höckes Unterbrechungen wirkten dabei wie ein zu laut aufgedrehter Lautstärkeregler. Er hatte dabei keinen spürbaren Kontakt mehr zum Inhalt des Gesprächs, noch zu seinem Gegenüber. Es schien, als könnte er nicht ohne. Kam er nicht weiter, verstummte er urplötzlich, sichtbar beleidigt wirkend.
Indem er weit mehr Redezeit in Anspruch nahm als Voigt, zeigt den Erfolg seines raumgreifenden Verhaltens. Dies zeigt auch, dass die beiden Moderatoren ihn nur mit großer Mühe einfangen konnten. Wie werden es andere Menschen wohl hinkriegen, die sich nicht so, wie die Moderatoren es geschafft hatten, in einem solchen kommunikativen Geschehen sich selbst und ihrer eigenen Überzeugung gegenüber treu und standhaft zu bleiben?
Höcke betont kurz nach 21 Uhr, er sei ein Patriot. Im Übrigen wäre doch seine frühere Rolle als Vertrauenslehrer Beleg dafür, dass man ihm vertrauen könne. Als kurz drauf Voigt ihm mehr Souveränität zu zeigen empfiehlt, bezeichnet er sich selbst als „reduziert“, Reduziert, da seine „Wutmöglichkeit“ (wie er es selbst bezeichnet) auf die Oppositionspolitik beschränkt sei. Betrachtet man die Bedeutung der Höckeschen Wortschöpfung ergibt sich schlussfolgernd eine besondere Bedeutung, die Rückschlüsse zulässt auf Höckes unausgesprochene Beweggründe. Diese geben Hinweise auf ein möglicherweise in Zukunft auftretendes Verhaltensmuster, mit dem man in der Politik rechnen muss. Ich möchte das an der Unterschidung verdeutlichen zwischen „wütend oder ärgerlich“ sein. Wut ist in der Regel eine intensivere Emotion als Ärger. Sie kann mit einem starken Gefühl der Empörung, des Zorns oder der Frustration einhergehen. Wut kann zu impulsivem Verhalten führen und ist oft von einem starken physischen und emotionalen Erregungszustand begleitet. Ärger ist im Vergleich dazu oft weniger intensiv. Wut kann eine kurzfristige Emotion sein, die jedoch intensiv und schnell auftritt.
Wut kann auch länger anhalten, besonders wenn die zugrunde liegenden Probleme nicht gelöst werden. Wut ist in der Regel eine intensivere Emotion als Ärger. Sie kann mit einem starken Gefühl der Empörung, des Zorns oder der Frustration einhergehen. Wut kann zu impulsivem Verhalten führen und ist oft von einem starken physischen und emotionalen Erregungszustand begleitet. Ärger ist im Vergleich dazu oft weniger intensiv. Wut kann länger anhalten, besonders wenn die zugrunde liegenden Probleme nicht gelöst werden. Wut wird oft durch eine Bedrohung oder eine Verletzung der persönlichen (emotionalen) Grenzen ausgelöst. Dies kann auch durch Frustration entstehen, wenn etwas nicht nach den eigenen Vorstellungen verläuft. Politiker können auch Wut als politisches Instrument nutzen, um Unterstützung für eine bestimmte politische Agenda zu mobilisieren. Sie könnten beispielsweise die Wut der Bevölkerung über eine bestimmte Angelegenheit nutzen, um politischen Druck aufzubauen und durch Eskalation Veränderungen herbeizuführen.
Wie kann man diesen Satz verstehen? Würde Höcke, so könnte man fragen, sich selbst souveräner erleben, wenn er Regierungschef in Thüringen wäre? Und nach Aufgabe der Oppositionsrolle, souveräner, weil dann seine Wut mehr Ausdrucksmöglichkeiten hätte? Wie würde das dann aussehen, was würden er und die AfD wohl machen? Nimmt man Höckes Wortschöpfung ernst, nimmt man ihn beim Wort, ist Wut uneingeschränkt erlaubtes Mittel der Politik. Die Frage ist dann nur, wie kann man mehr Möglichkeiten schaffen, politisch wütend sein zu können. Wut ist bei Höcke nicht nur ein Gefühl sondern eine Haltung.
Stress entlarvt
Höcke und Voigt waren verständlicherweise unter Stress. Beide unterschieden sich während des Duells im Auftrittsverhalten jedoch durch Ihr Stressmanagement. Höcke zeigte von Anfang an verschiedene Formen von Anspannung und Anstrengung. Diese wurden besonders dann deutlich, wenn er durch die Moderatoren sowie durch Voigt konfrontierend unterbrochen wurde. Er solle doch endlich deutlich „ja“ oder „nein“ sagen. Statt einer klaren Ich-Aussage, durch die er sich ungeschminkt hätte politisch festlegen müssen, dienten seine allgemeine Aussagen dazu, ausweichend seine geheimen Ansichten zu verbergen. Ansichten, mit denen er bei Veranstaltungen in seinem politischen Milieu nicht hinter dem Berg hält.
Eine erneute Aufforderung seitens der Moderatoren ließ Minuten später Höckes Gesicht wie eine regungslose Maske verfinstern. Gelegentlich errötete sein Gesicht, die Lippen blieben zusammengepresst, der Blick streng fokussiert auf sein Gegenüber. Die Lautstärke seiner Stimme sowie seine Gestik verstärkten dabei den nicht mehr zu bremsenden, überbordenden inneren emotionalen Druck. Solche Momente zeigten deutlich und unmissverständlich den Zwiespalt, der sich zwischen inhaltlicher Diskussion und der Selbstdarstellung Höckes auftat. Nicht nur das. Sollte diese Art der Selbstdarstellung doch dazu dienen, dem andern keinen Raum zu geben. Dies geschieht mit der Absicht den Andern so zu bemächtigen, dass er sich selbst nicht mehr spüren kann und dann verstummt. Voigt verstummt nicht.
Intensiviert durch das nicht übersehende (besser: nicht zu überhörende) Spannungsgeschehen, schien Höckes Selbstdarstellung auch dazu zu dienen, sein Gegenüber an sich „binden“ zu wollen. Dies geschah nicht durch überzeugende Logik sowie Fakten basierte politische Argumente, sondern durch den raumgreifenden Habitus des Politikers. Dem Andern den eigenen Raum so zu beschneiden trägt Züge von Respektlosigkeit im politischen Miteinander.
Selbst die Moderatoren, offensichtlich gut in der Steuerung politischer Debatten geübt, hatten zeitweise Schwierigkeiten, sich dagegen zu wehren und sich zu behaupten. Aus der Perspektive von Höckes Erlebens- und Verhaltensmustern betrachtet, muss dieser sich dann deutlich emotional in die Enge gedrängt gefühlt haben. Sich so in der Enge zu erleben und unkontrolliert zu reagieren, spiegelt sowohl Höckes fehlende Souveränität als auch seine Neigung, sein Gegenüber letztendlich „überwältigen“ zu wollen.
In sich und um sich selbst drehend
Gleich zu Anfang des Duells zeigte Höcke eine typische eher unbequeme Körperhaltung. Er nahm sie spontan ein, als er das erste Mal Voigts Antwort auf die von den Moderatoren gestellte Eingangsfrage lauschen musste. Leicht zur Seite gebeugt, stützte er mit seiner Faust sein Kinn und verharrte in dieser Position. Andere stützen in einer ähnlichen Situation ihr Kinn nut mit einigen Fingern.Dabei huschte regelmäßig und doch auch überraschend, ab und an ein Lächeln über sein Gesicht. Blickte er dann hoch, was er in einer solchen Situation oft tut, schien er mit sich selbst beschäftigt zu sein. Zwar hörte er sein Gegenüber, zwar war er thematisch wach und doch hörte er nicht zu. Er kann nicht zuhören, ist er doch zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Dabei eher ungelenk bemüht, sich selbst wieder in Position zu bringen, statt durch Argumente oder die Bezugnahme auf Fakte zu erwidern. Er will sich offensichtlich durch sein Auftrittsverhalten selbst zum besten Argument machen. Es müsste doch, so könnte seine insgeheime Überzeugung sein, ausreichen, ihm als Person zu glauben, weil er dies oder jenes sagt.
Ein Faktencheck wäre daher beinah vergebens. (Natürlich ist eine Fakten gestützte Auseinandersetzung weiterhin vonnöten) Höckes Lächeln in solchen Momenten scheint sein Überlegenheitsgefühl zu spiegeln. Ich bin doch selbst das beste Argument, hieße dann, sein Gegenüber und dessen Bemühen im Gespräch für überflüssig zu erklären.
Ein solcher Blick auf Höckes Verhaltensmuster verdeutlicht die Notwendigkeit und Dringlichkeit sich als Zuschauer eines solchen TV-Duells sowohl die politischen Inhalte und hierauf bezogenen Argumente kritisch anzuhören einerseits. Andererseits drängt in Zeiten von Social Media und Rechtspopulismus der Politiker mit seinen typischen Verhaltensmustern verstärkt, oft ungeschminkt in den Vordergrund der Wahrnehmung. Vertritt er doch durch seine persönliche Wirkung in der Öffentlichkeit die Politik der von ihm vertretenen Partei. Je deutlicher und öfter er vor allem im / als Bild öffentlich wahrnehmbar ist, desto prominenter wirkt er auf die Menschen. Prominenz kreiert heutzutage Vertrauen und Überzeugungskraft. Erleben Menschen das wie: „den kenn ich doch“, scheinen sie virtuell diesen Politiker zu sich auf die Couch im eigenen Wohnzimmer einzuladen.
Höcke hat sich durch das TV-Duell einen deutlichen Aufmerksamkeitsbonus erobert. (Voigt auf eine völlig andere Art ebenso)
Höcke schlüpft in die Rolle eines Erretters
Bezieht Höcke sich auf Voigt, spricht er ihn direkt an oder bemüht sich zu kontern, fällt die Neigung auf, Voigt kurz anzuschauen, um dann den Blick auf den Boden zu senken und den Blickkontakt zu unterbrechen. Was aber frage ich mich, passiert, wenn in einem Duell einer der Duellanten seinen Blick vom Gegenüber abwendet. Er würde einfach verlieren. Bezieht man Höckes Kontaktmuster auf ein Kommunikationsduell, verweigert Höcke eine Grundbedingung von Kommunikation, nämlich Kontakt. Ohne Kontakt läuft aber gar nichts. Ohne Kontakt in der Beziehung zum Gegenüber ist der Redebeitrag lediglich ein Monolog, eine Selbstaussage, eine bloße Behauptung. Höcke scheint diese Art von Selbstdarstellung zu favorisieren. Argumente oder Inhalte dienen dann als Worthülsen oder gar als Täuschung.
Höcke zeigt in solchen Momenten, dass er keinen Kontakt zu seinem Kontrahenten Voigt will, sondern lediglich zum virtuell anwesenden Zuschauer. Voigt will das auch. Dies ist ja auch Sinn eines TV-Duells bei guter Sendezeit.
Da Höcke in einer solchen Situation den Kontakt zu seinem Gegenüber vermeidet, man sich aber mit ihm politisch auseinandersetzen will, besteht die wesentliche Aufgabe, wie man Höcke „in Kontakt zum Gegenüber bringen kann“. Den Moderatoren und auch Voigt dies immer wieder gelungen. Je aufgebrachter Höcke reagierte, desto eher schien er seine Fassung zu verlieren. In solchen Momenten, stotterte und verhaspelte er sich. Er machte lange Pausen, um dann stark gebremst wirkend, mit betont langsamer Stimme weiterzureden. Er wirkte dann in seiner Abwehr präsent. Einerseits gäbe es Erinnerungslücken, und das sei doch menschlich. Beim Thema „Remigration“ ruderte er überraschenderweise einfach zurück, indem er eine völlig neue Interpretation lieferte. Andererseits suchte er nach Ausflüchten, Verharmlosungen, Verallgemeinerungen oder bezeichnete sich, menschlich wirkend wollend, überbetont als emotional. Nonverbal drückte er das dadurch aus, dass er seine Schultern nach vorne geschoben festhilet, seinen Kopf nach vorne beugte, die Oberarme an den Rumpf gedrückt und die Brust eingezogen die nach vorne gebeugte Haltung mehrmals wiederholte . Seine unausgesprochene Botschaft an das virtuelle Publikum schien darin zu bestehen, sich durch körperlich klein zu machen und sich gerade hierdurch als Märtyrer in Erinnerung zu bringen. Er sei doch der Demokrat und müsste sich gegen die unhaltbaren Unterstellungen der Medien sowie der Politik deutlich zur Wehr setzen. Und im Übrigen würde er nicht verstehen, dass er als Demokrat nicht nach Buchenwald eingeladen worden sei.
Höcke ist beim TV-Duell mit dem Ziel angetreten, die Debatte im Studio als Bühne der Selbstpräsentation zu nutzen. Voigt tat dies auch. Der Unterschied bestand in der Intention der Beiden. Voigt zeigte sich als bislang weitgehend unbekannter Politiker, um seine Umfragewerte und die der Thüringer CDU zu erhöhen. Höcke hingegen bot sich an als Identifikationsfigur für Menschen, die ihn in anderen Kontexten feiern oder bejubeln. Er nutzte rechtspopulistische Verhaltensmuster, um Menschen unbewusst, emotional an sich zu binden, indem er sich als attraktiven Politiker darzustellen bemüht war. Dies Bemühen um Attraktivität bestand während der Debatte nicht in der seriösen Klärung von politischen Inhalten / Themen. Diente es doch primär dazu, das Identifikationsbedürfnis von Menschen in verschiedenen gesellschaftlichen Milieus zu bedienen. Von Menschen, die sich besonders ohnmächtig, orientierungslos oder ängstlich erleben; daher verzweifelt ihre Hoffnung in die Versprechungen von Höcke, der AfD und anderen rechtsgerichteten Versprechungen legen.
Diese Menschen spüren nicht mehr ihre eigene Selbstwirksamkeit, nämlich „sich trotz aller Krisen und gesellschaftlicher Verwerfungen dem Geschehen in der Welt nicht gänzlich ohnmächtig ausgeliefert zu sein“). Diese Menschen erleben in ihrem Alltag keine Wirkmächtigkeit mehr, die darin zum Ausdruck kommen könnte: „Ich warte nicht nur auf die großen Veränderungen durch die Politik, sondern beginne selbst in meinem Umfeld meinen Beitrag zur Verbesserung der Welt beizutragen“. Diese Menschen ersehnen sich Jemanden, der sich als „Retter“ oder „Erlöser“ mit der Botschaft anbietet: „Ihr müsst mir nur vertrauen. Glaubt an mich. Seht her, mir geht es so wie euch. Verlasst euch auf mich. Ich bin mir nicht zu schade, meinen Kopf zu riskieren, damit es Euch und uns wieder besser geht.“
eim großer Dank geht auch an meinen Freund Dr. Günter Rückert für seine wunderbaren, weil treffenden Skizzen
