Vor- und Nachteile geschriebener Verfassungen
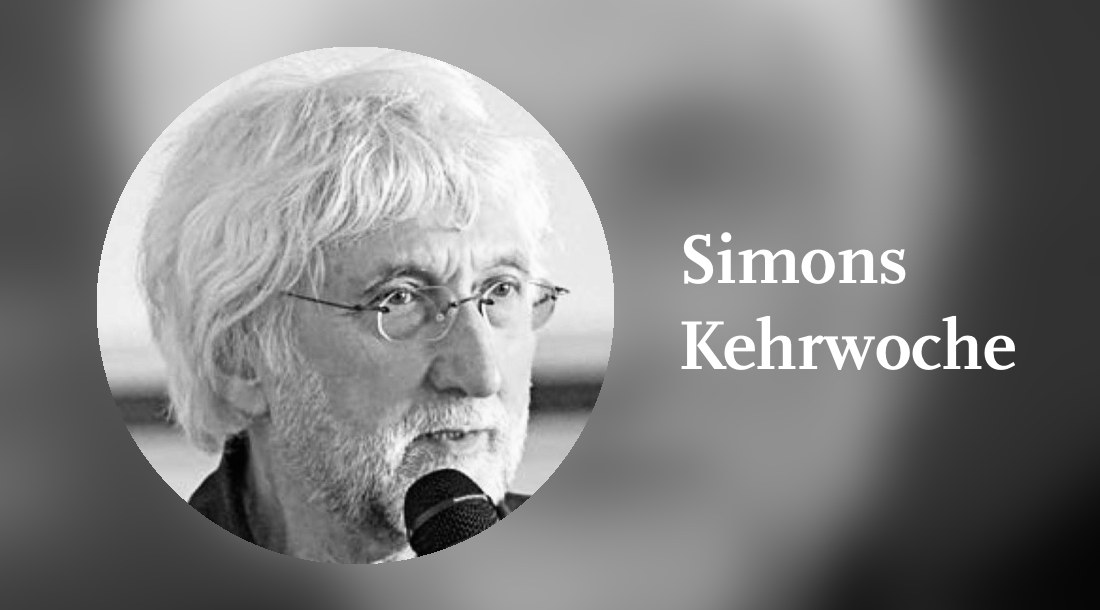
Der Supreme Court hat in GB entschieden, dass die „Prorogation“ des Parlaments durch die britische Regierung gegen die Verfassung verstößt. Durch diesen Richterspruch ist Klarheit in eine Situation gebracht worden, die bis dato noch nie in der britischen Geschichte vorgekommen ist, d.h. neues Recht wurde geschöpft.
Dieser Vorgang ist deswegen (u.a.) interessant, weil es in GB keine geschriebene Verfassung gibt. Anlass genug, sich Gedanken über Chancen und Risiken geschriebener Verfassungen zu machen. Schriftlichkeit schafft immer eine gewisse Konstanz. Ein Gesetzestext kann im Laufe der Geschichte zwar immer wieder neu interpretiert werden, aber der Text kann (zumindest bei Verfassungen) nur unter Schwierigkeit (z.B. Zweidrittelmehrheit) geändert werden.
Das sorgt für eine gewissen Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit der praktizierten politischen Spielregeln. Das dürfte unter den Pluspunkten zu verbuchen sein. Unter den Minuspunkten steht dagegen in der Rechnung, eine nicht zu unterschätzende Einschränkung der Flexibilität des Systems, da Regelungen, die vor langer Zeit beschlossen wurden, immer noch gelten, obwohl sich die Welt verändert hat. Ein Beispiel dürfte das in der US-Verfassung verbriefte Recht der Bürger, Waffen zu tragen, sein. Was in Zeiten, als der Westen kolonisiert und die „Indianer“ unterjocht wurden, sinnvoll gewesen sein mag (verabschiedet am 15. Dezember 1791), ist heute obsolet – bleibt aber als Recht bestehen…
In langlebigen Familienunternehmen, die hier mal als Vergleichsmodell genutzt sein sollen (ob das angemessen ist, steht natürlich zur Debatte), sind schriftliche Verfassungen immer problematisch, da sie den Zwang unter den Gesellschaftern, sich bei anstehenden Entscheidungen zu einigen, reduzieren. Derjenige, der befürchtet, im Konfliktfall zu verlieren, geht vor Gericht. Wenn keine Verfassung (bzw. irgendein damit verbrieftes Recht) existiert, ist die Versuchung weit geringer, das Machtspiel in den Bereich der Justiz zu verlagern. Der Preis dafür ist, dass die Mächtigen nur schwer in Frage gestellt werden können. Daher hängt es entscheidend von der jeweiligen (Familien-)Kultur (Stichwort: Vertrauen) ab, ob eine schriftliche (Familien-)Verfassung nützlich oder schädlich ist. Zurück zu GB. Hier scheint mir durch den Mangel an einer schriftlichen Verfassung die Versuchung der formalen Machthaber, diese Macht auszuweiten, getriggert worden zu sein. Wenn in der Hinsicht ein Verfassungstext klare Leitlinien gegeben hätte, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Auf der anderen Seite hat jetzt ja das Gericht die Chance genutzt, die Evolution der praktizierten Verfassung weiter zu treiben…
(Aus meiner persönlichen Sicht: Es ist noch einmal gut gegangen, aber dass das in all den Ländern, wo Populisten an der Macht sind, ebenfalls funktioniert, scheint mir zweifelhaft; allerdings: Wenn die Populisten – wie in Ungarn – Zweidrittelmehrheiten in ihrem Parlament haben, hilft eine schriftliche Verfassung auch nicht.)

