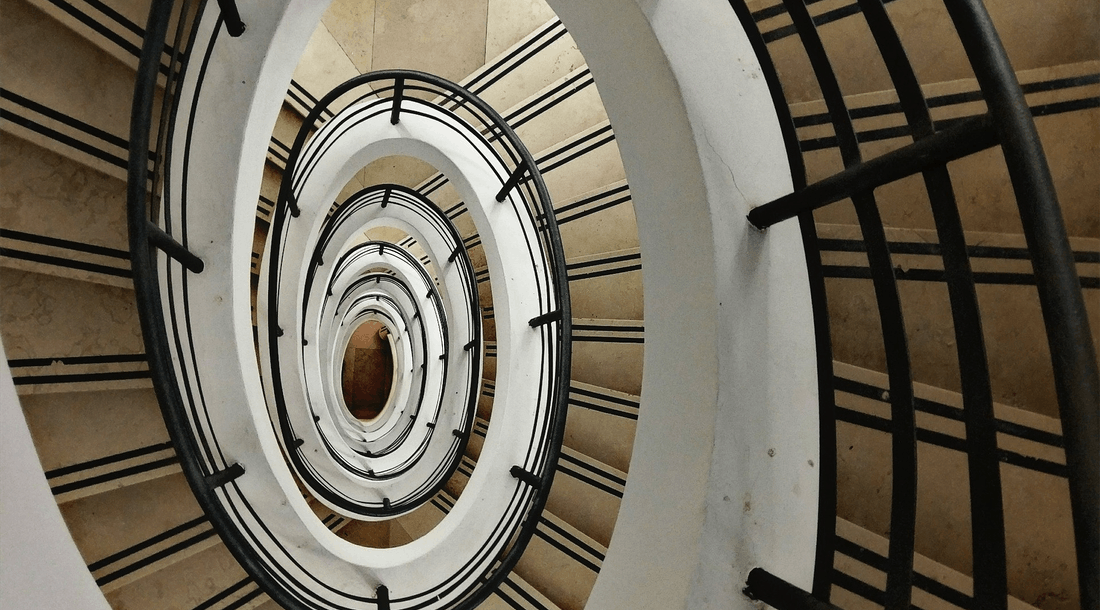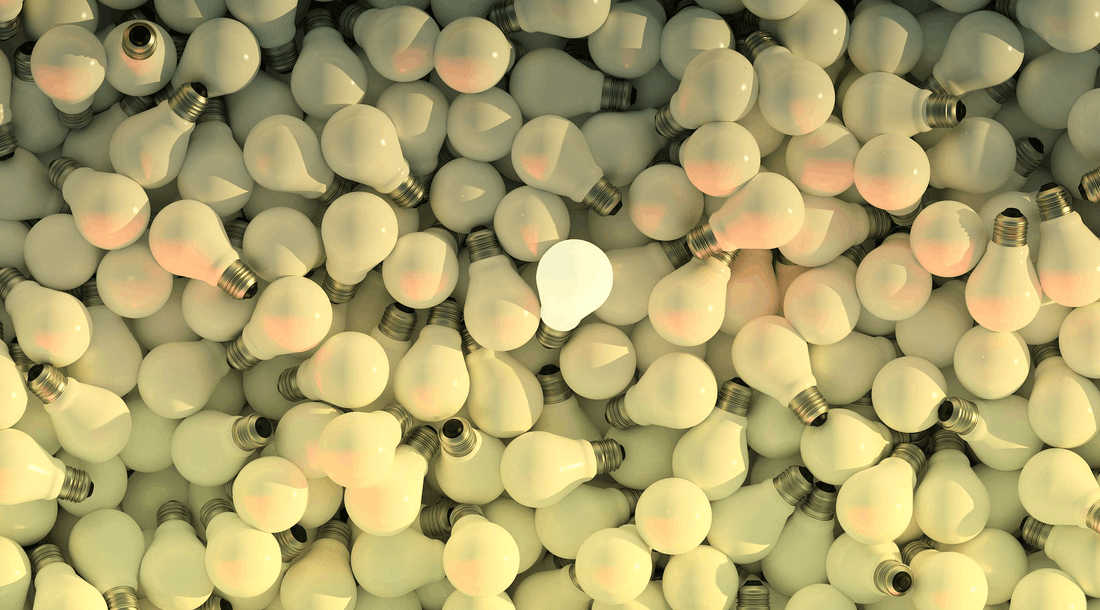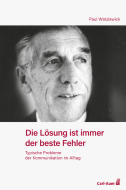Realitätenkellner*in: Diagnosen verflüssigen

Es war einmal eine informative Veranstaltung zum Thema Soziale Diagnose. Eine sehr engagierte Vortragende berichtet uns über Neuerungen in dem Fachbereich. Ich bin sehr angetan von der Kompetenz der Kollegin. Zwischendurch applaudiere ich daher. Es gib auch eine Aussage, mit der ich nicht vollends übereinstimmen kann. Die Kollegin stellt den biographischen Zeitstrahl vor, ein Werkzeug, um die Biografie eines Menschen systematisch zu erheben.
Ich kenne das Instrument und erachte es für sinnvoll.
Ich kann den O-Ton nicht mehr korrekt wiedergeben, aber in etwa meint die Kollegin, dass mit dem biographischen Zeitstrahl die Vergangenheit eines Menschen erhoben werden könne. Diese würde analysiert und aus der Vergangenheit könnte eine Sozialarbeiterin sozialdiagnostische Rückschlüsse ziehen. Sozialarbeiterinnen seien Expertinnen in der Sozialen Diagnose und könnten daher Ableitungen machen, ganz so wie Ärztinnen aus Röntgenbildern Ableitungen machen.
Diese Aussage möchte ich hypnosystematisch diskutieren.
Zunächst möchte ich meinen FachkollegInnen versichern, dass ich viele Instrumente der Sozialen Diagnose oder auch des Assessement als sinnvoll und hilfreich erachte. Sehr sinnvolle Instrumente stellen unter anderen Heiko Kleve, Britta Haye, Andreas Hampe und Matthias Müller in deren Buch „Systemisches Case Management“ vor. Ich selbst lehre auch (einige) diese(r) Instrumente.
Die Meinung der Kollegin, Sozialarbeiterinnen könnten „die“ Vergangenheit von KlientInnen anhand eines Zeitstrahles erkennen, ist für mich interessant, da ich an der Aussage einige zentrale Prinzipien des hypnosystemischen Konzeptes verdeutlichen kann.
Ich bin der Kollegin dafür sehr dankbar und muss mich bei Ihr dafür entschuldigen, dass Sie im Zuge des Blogs keine Möglichkeit hat, direkt zu reagieren oder ein Statement dazu abzugeben.
Kommen wir zu der Aussage zurück. Diese impliziert einige Vorannahmen, Präpositionen:
• Es gibt eine „Vergangenheit“.
• Sie existiert wie ein Objekt: Sie ist irgendwo als „Vergangenheit“.
• Dieses Objekt „Vergangenheit“ ist eindeutig erkennbar.
• Es sind alle Informationen verfügbar, die zu diesem Objekt „Vergangenheit“ gehören.
• Die „Vergangenheit“ ist irgendwo in der Klientin drinnen.
• Der biographische Zeitstrahl erfasst diese Vergangenheit. Genau diese eine.
• Das Instrument verfügt über die Möglichkeiten zu erkennen, zu beschreiben und auszuwerten. Es kann umfassend alle Informationen miteinander systematisieren und eindeutig auswerten.
• Das Erkennen / Beobachten ist unabhängig vom Erkennenden / Beobachtenden.
• Es gibt allgemeine, objektive Richtlinien, an denen „Vergangenheiten“ orientiert, kontextualisiert und in Indikatoren zugeordnet werden können. • Die Sozialarbeiterin kann das Erfasste eindeutig analysieren und bestimmen.
• Andere SozialarbeiterInnen können anhand des Instruments wiederholbar und unabhängig voneinander immer dieselbe objektive „Vergangenheit“ erkennen.
Diese Punkte erinnern mich an diverse Positionen in der Psychologie, Soziologie oder der Beratungsforschung:
Zum einen erscheint mir dieser Standpunkt als positivistisch, insofern, als dass an ein Objekt geglaubt wird, das erkannt werden kann. Das Objekt kann unabhängig vom Beobachtenden / Erkennenden wahrgenommen werden. Es ist da, quasi wie ein Baum, den jedeR sehen kann. Das Phänomen existiert für sich und aus sich heraus, ähnlich einem gebrochenen Knochen, der durch das Röntgen sichtbar gemacht werden kann. Zum anderen erinnert mich diese Haltung an das Arzt-Patienten-Modell, das Edgar Schein beschreibt. Edgar Schein zufolge handeln BeraterInnen immer dann nach dem Arzt-Patienten-Modell, wenn Sie davon ausgehen, dass sie ExpertInnen wären, die ein Problem eindeutig diagnostizieren und dafür dann eine Lösung anbieten könnten, eben wie eine Ärztin einer Patientin das richtige Medikament verschreibt.
Zuletzt erinnert mich dieses Vorgehen auch eine psychoanalytische oder tiefenpsychologische Haltung, in dem Sinne, dass es eine Vergangenheit an und für sich gebe und diese Vergangenheit für das jetzige Leben eines Menschen Bedeutung habe, ganz so wie ein Stau, der sich aktuell auf eine Autofahrerin auswirkt.
Dabei weiß ich nicht, ob die Kollegin diese Standpunkte so intendiert hat. Ich möchte diese Aspekte hypothetisch und exemplarisch heranziehen, um das hypnosystemische Integrationskonzept und dessen Prämissen darzustellen.
Hypnosystemisch könnte dies anders betrachtet werden. Und ich möchte sehr gerne eine hypnosystemische Perspektive andeuten.
Zuallerst beginnen wir beim Prozess des Beobachtens und den erkennenden Subjekten. Gunther Schmidt bezieht sich auf unterschiedliche Arbeiten, um seine epistemologischen Schlussfolgerungen zu ziehen:
Zum einen wäre da Paul Watzlawick zu nennen, ein Vertreter des Konstruktivismus. Kurz zusammengefasst besagt der Konstruktivismus, dass es nicht bloß eine objektiv wahrnehmbare Wirklichkeit gebe, sondern Menschen subjektive Wirklichkeiten erzeugen. Wirklichkeit ist nicht auf einer Ebene angesiedelt, sondern auf zwei: Es gibt die sogenannte objektive Welt, also die Welt der physikalischen Entitäten (Baum, Tisch …). Diese Welt wird verbunden mit der subjektiven Welt, eine Wirklichkeit der zweiten Ordnung (Weihnachtsbaum, Operationstisch …).
Menschen nehmen sinnesspezifische Objekte UND deren subjektive (soziokulturelle) Bedeutung zugleich wahr.
Zum anderen wäre da Gerald Hüther zu nennen, ein Vertreter der (post-)modernen Neurobiologie. Die Forschungsergebnisse der Neurobiologie besagen, dass Vergangenheit im Gehirn nicht einfach „ist“. Im Moment des Erinnerns wird Vergangenheit rekonstruiert. Der österreichische Kabarettist Gunkl fasst es in der lapidaren Aussage zusammen: „Das ist so, als würdest Du ein Buch lesen und, während Du es liest, schreibst Du das Buch um.“
Wenn aber Wirklichkeit rekonstruiert wird, dann ist sie keine objektive Entität, die eindeutig und wiederholbar festgestellt werden kann. Dann ist Vergangenheit ein lebendiger, subjektiver und situativer Prozess.
Zudem, so betont Gunther Schmidt, legt uns die Neurobiologie nahe, nicht von „einer“ Vergangenheit zu sprechen, sondern von „Vergangenheiten“. Das Episodengedächtnis speichert und systematisiert das menschliche Erleben ab und bietet die biographischen Erfahrungen als ein Erlebens- und Verhaltensreservoir an. Jedes Erleben, das mit starken Emotionen vernetzt wird (so die Kurzfassung) wird im Episodengedächtnis abgespeichert und steht Menschen zur Verfügung.
Insofern haben wir nicht nur eine Vergangenheit. Das ist eine Vorstellung. Die Neurobiologie zeigt uns, dass wir viele Episoden in uns gespeichert haben, also Vergangenheiten rekonstruieren können.
Wenn die Vergangenheit im Jetzt-Moment rekonstruiert wird, wird sie kontextuell rekonstruiert: in einem gewissen Setting, in einer gewissen Situation, in einer gewissen Beziehung. Diese Kontextfaktoren haben eine Bedeutung.
In der Sozialen Diagnostik, so eine erste Schlussfolgerung, könnten die Kontextfaktoren berücksichtigt werden. Es ist, so eine erste Hypothese, wichtig, wer wann und wo und wie und wodurch und wofür ein Instrument anwendet. Edgar Schein formuliert es lapidar: „Alles was Du tust, ist eine Intervention“. Wie ein Instrument zur Anwendung kommt, ist daher auch bereits eine Intervention.
Eine zweite Hypothese lautet: „die“ Vergangenheit – beziehungsweise „die Vergangenheiten“ – sind zu komplex, zu vielschichtig und zu mehrdimensional, um diese eindeutig in einem Instrument abzubilden. Das Instrument bildet Teilaspekte einer viel umfassenderen Vergangenheit – beziehungsweise Vergangenheiten – ab.
Drittens kann festgehalten werden: Wenn die Vergangenheit mit einem Instrument erhoben wird, dann wird diese „verfestigt“. Es wird so getan, als wäre dies „die“ Vergangenheit. Sie könnte auch „verflüssigt“ werden, also eine mögliche Perspektive, als eine Nuance oder auch Facette. Sie könnte verflüssigt werden als das, was dies sein könnte: Das Ergebnis, das dabei herauskommt, wenn dieses Instrument in dieser Zeit in diesem Gespräch angewandt wird.
Sie kann dahingehend verflüssigt werden, dass die Vergangenheit im Jetzt gestaltbar, veränderbar ist. Welche Vergangenheit hätten Sie denn gerne in der Zukunft? Ben Furman formuliert es recht eindrücklich in dem Buch: „Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben.“
Viertens, so formuliert es Gunther Schmidt, legt uns die (post-)moderne Hirnforschung nahe, dass eine Vergangenheit an und für sich keine Wirkkraft habe. Vielmehr entfaltet das Wirkung, was im Jetzt als Vergangenheit rekonstruiert wird. Und damit ist es kein Ding, das wirkt, sondern ein Prozess. Und Prozesse sind veränderbar.
Eine fünfte Hypothese formuliere ich dazu noch: Das Darstellen oder Analysieren dieser Vergangenheiten hat an und für sich keinen Zweck oder Wert. Es ist „leer“. Es muss mit Sinn und Zweck gefüllt werden. Wir brauchen also erkennende und zugleich erzeugende Subjekte, die etwas wahrnehmen, festhalten und dann interpretieren. Zuletzt ist die Frage zu klären: Wofür wird das getan?
Das Instrument ist ein Mittel zu einem Zweck. Was ist der Zweck? Woran wird dieser gemessen? Meines Erachtens werden Instrumente in Sozialen Gesprächen dazu eingesetzt, dass die KlientInnen einen Mehrwert und Nutzen davontragen. Gunther Schmidt nennt dies Zieldienlichkeit: Hypnosystemisch können wir Instrumente dahingehend überprüfen, ob diese zieldienlich zur Anwendung kommen. Welchen Nutzen und Mehrwert die Anwendung dieses Instrument „für dieseN KlientIn“ bietet.
Zudem wird einE AnwenderIn damit auch zur RealitätenkellnerIn. Wenn die Vergangenheit subjektiv und situativ rekonstruiert wird, wird etwas gemeinsam produziert. Gemeinsam wird ein Ergebnis erzeugt. Dieses Ergebnis ist ein Angebot einer Wirklichkeitsdeutung. Das Kellnern einer Realität.
Gunther Schmidt spricht davon, Gespräche mit Bedeutung aufzuladen. Einen Zweck zu geben. Realitätenkellner handeln Zweck und Ziel mit KlientInnen aus. Sie bieten dann hypothetische Wirklichkeitskonstruktionen an. Im Unterschied zu ÄrztInnen bieten wir dann keine feststehenden, objektiven Tatsachen an, etwa einen Beinbruch. Wir bieten Perspektiven, Wahrheiten, Wirklichkeiten und Möglichkeiten an.
Insoo Kim Berg soll gesagt haben: „Die ist eine Möglichkeit es zu sehen. Es gibt auch eine andere.“ Das Ergebnis des biographischen Zeitstrahls kann Ausgang eines interessanten Gespräches werden. Im Zuge dessen wird die Bedeutung und Zieldienlichkeit ausgelotet.
Dabei ist es im hypnosystemischen Konzept eine Grundprämisse, kompetenzakivierend zu handeln. Also die Art und Weise des Erstellens und sich Austauschens aktiviert bei KlientInnen Kompetenzen. Diese Kompetenzen sind für die KlientInnen hilfreich, etwa im Bewältigen des gelingenden Alltags.
Für das Anwenden von Instrumenten kann das Prinzip der Kompetenzaktivierung eine gute Leitlinie darstellen.
All diese Aspekte können in Fragen zusammengefasst werden; wichtig zu fragen kann daher sein:
• Inwieweit wirkt dieses Instrument kompetenzaktivierend und lösungsorientiert im Zuge unseres Gespräches.
• In Bezug auf welches Ziel ist dies eine sinnvolle Vorgehensweise?
• Welche Auswirkung hat das Instrument als Intervention?
• Wie wirkt diese Auswirkung zieldienlich?
• Welche Bedeutung hat diese Art des gemeinsamen Vorgehens für den/die KlientIn entfaltet?
• Und inwieweit ist dies hilfreich für die Bewältigung des eigenen gelingenden Alltags? In der Bewältigung des gemeinsamen Zieles? In der Erfüllung des Auftrages an die Soziale Arbeit (Stichwort: Doppeltes Mandat)?
Ich möchte an dieser Stelle einen zwischenzeitliches Resümee stellen.
Hypnosystemische Perspektiven können für die Soziale Arbeit methodisch wichtig und wirksam sein. Gunther Schmidt gibt viele Modelle und Vorgehensweisen in die Hand, mit denen eine unterstützende Kommunikation aufgebaut und strukturiert werden kann. Dabei ist das Modell des Realitätenkellner sehr hilfreich, das aktuelle neurobiologische Forschungserkenntnisse miteinschließt. Es verhilft uns zu einer reflektierten Perspektive auf Techniken in der Sozialen Arbeit und schärft unsren Blick dafür, was eine Intervention ist und wie diese sich auswirkt.
Der Realitätenkellner und dessen neurobiologisches Fundament vermitteln uns ein anderes Bild zu den gedanklichen Konzepten „Vergangenheit“, „Gegenwart“ und „Zukunft“. Sie bieten uns eine prozessuale, konstruktive (konstruktivistische) Position dazu an, die Wahlmöglichkeiten und Handlungsfähigkeit herstellten kann.
Hypnosystemische Perspektiven können – unter anderem – auch in der Entwicklung und Anwendung von Instrumenten der Sozialen Diagnostik interessant sein. Sie zeigen auf, auf welchen Vorannahmen und Konzepten unser Vorgehen beruht und laden uns dazu ein, dies gegeben Falls zu hinterfragen.
Diagnosen zu verflüssigen, bietet für die Soziale Arbeit eine sehr große Chance: Damit werden scheinbare Objekte zu Prozessen redynamisiert und können gestaltbar gemacht werden.
Das Ausführen eines biographischen Zeitstrahl könnte demnach defizitorientiert oder ressourcenorientiert vonstattengehen. Es könnte expertenorientiert vonstattengehen, in dem Sinne, dass die Sozialarbeiterin die Expertin für die Durchführung sei und auch das Ergebnis einseitig und eindeutig bestimmen könne. Es könnte auch kooperativ vonstattengehen, in dem Sinne, dass ein gemeinsames Ergebnis erzielt werde, wobei im Zuge des Prozesses die gemeinsame Arbeit dahingehend geprüft wird, inwieweit sich diese auf das Gesprächsziel positiv auswirke.
Das Ziel im hypnosystemischen Integrationskonzept ist es, Kompetenzen zu aktivieren. Dies, so meine finale Schlussfolgerung für diesen Blogartikel, möge auch für die Soziale Diagnostik ein Leitmotiv sein.
In weiteren Blogartikeln können all diese Ideen vertieft werden.