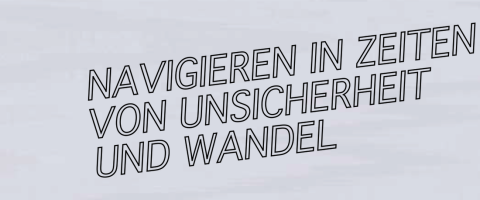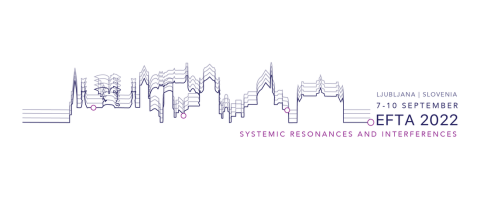35. EPF-Jahrestagung
IDEALE.

Für die 35. Jahrestagung, die in Wien stattfinden wird, dem Geburtsort der Psychoanalyse, haben wir das Thema Ideale gewählt. Viele von Ihnen werden sich erinnern, dass die EPF die 33. Jahrestagung 2020 in Wien abhalten wollte, wir dann aber aufgrund der Pandemie gezwungen waren, die Veranstaltung sehr kurzfristig abzusagen. Das Programm zum Thema Realitäten haben wir aber nicht gestrichen und es 2021 gezwungenermaßen als Online-Tagung durchgeführt. Nun gehen wir nach Wien mit diesem neuen Thema.
Betrachten wir zunächst kurz die Etymologie des Begriffes „Ideal“. Jorge Canestri stellte im EPF-Bulletin 55/2001 fest, dass der Begriff „Ideal“ zusammen mit „Idol“ eine gemeinsame Wurzel im griechischen Wort „idéa“ hat, was „sehen“ bedeutet. Die wörtliche Bedeutung des griechischen idéa ist „Gestalt, Form, Erscheinung…, und obwohl dieser Terminus in der Philosophie bereits von Demokrit in der Bedeutung von ‚Gestalt oder sichtbares Schema‘ benutzt wurde, [folgt] der weitere Werdegang des Begriffs ganz der Platonischen Philosophie, insofern er die Bedeutung eines abstrakten Modells und Ideals übernahm, das wir als Vergleichsmaßstab heranziehen“. Canestris Überlegung legte den Schwerpunkt auf „die Notwendigkeit eines ständigen Oszillierens zwischen Sehen und Denken, Form und Vorstellung, Bild und Abstraktion“, und mit der Hinwendung zu Freuds Der Mann Moses und die monotheistische Religion zitierte er die wohlbekannte Aussage aus jenem Spätwerk zur menschlichen Entdeckung des Geistes zum Kind, das sich von einem Elternteil dem anderen zuwendet:
„Aber diese Wendung von der Mutter zum Vater bezeichnet überdies einen Sieg der Geistigkeit über die Sinnlichkeit, also einen Kulturfortschritt, denn die Mutterschaft ist durch das Zeugnis der Sinne erwiesen, während die Vaterschaft eine Annahme ist, auf einen Schluss und auf eine Voraussetzung aufgebaut. Die Parteinahme, die den Denkvorgang über die sinnliche Wahrnehmung erhebt, bewährt sich als ein folgenschwerer Schritt“ (GW XIV, S. 221ff).
Freud hatte den Begriff „Idealich“ 1914 in seiner Schrift Zur Einführung des Narzissmus zum ersten Mal konzeptualisiert, 1923 dann in Das Ich und das Es, er unterschied aber nicht zwischen Idealich und Ich-Ideal. Freuds Nachfolger begannen, bestimmte Unterscheidungen vorzuschlagen. Lacan (1966) beispielsweise differenzierte zwischen Ich (Moi), Idealich (Moi idéal) und Ichideal (Idéal du Moi). Das Ich wird in der Spiegelphase des Kindes als Körper-Ich vermittelt, während das Idealich ein Körpermodell idealisierter Anderer ist, das das Ich in eine Spannung bringt. Das Subjekt misst sein Ideal nicht an sich selbst, sondern an dem Bild, welches in seiner Vorstellung für einen Anderen begehrenswert ist. Dieses Bild ist sein Idealich. Ein Dritter vermittelt also Anerkennung oder Verweigerung der Anerkennung („der Andere mit großem A“). Wenn das Subjekt sich mit diesem Anderen und dessen Urteil hinsichtlich des Idealichs identifiziert, entsteht das Ichideal. Das Ichideal sorgt für die Regulierung der Beziehung zwischen dem Ich und dem Idealich. Und über das vom Anderen stammende Ichideal entsteht Symbolisierung. Somit gehört das Idealich als Bild zum imaginären Register, während das Ichideal als Ergebnis einer auch sprachlich vermittelten Identifizierung mit einem bedeutsamen Anderen dem symbolischen Register angehört (wir verzichten hier auf die Diskussion des Verhältnisses von Moi und je).
All diese Differenzierungen haben mit der Frage zu tun, wie Ideale zur Entstehung und Beibehaltung libidinöser und objektgerichteter Ziele dienen können oder wie sie im Interesse von Zielen auf der Ebene der Verteidigung eines primären Narzissmus bei Individuen und Gruppen eingesetzt werden können, die potenziell destruktiv sind. Folgt man der Entwicklung psychoanalytischer Theorien zum Thema Ideale seit Freud, können wir feststellen, dass Übereinstimmung darüber besteht, dass sie die Strukturierung des psychischen Lebens fördern, aber auch tyrannisch und quälend werden können, während das Fehlen von Idealen zu Gefühlen von Desorientierung, emotionaler Leere und Hoffnungslosigkeit führen kann.
Für Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker ist ein optimaler Modus der Ausübung von Psychoanalyse das, was sich in Sigmund Freuds Praxisraum in Wien abspielte. Er entwarf die günstigste Behandlungsform für die Hysterie. Obwohl sich sein Setting überwiegend beiläufig entwickelte, wurde es schnell zum Standardverfahren, Psychoanalyse zu praktizieren. Die Struktur der analytischen Sitzungen und die Art des Zusammenseins mit dem Patienten wurden zur Methodik: weil sie gut funktionierte. Könnten wir zustimmen, dass diese etablierte Art und Weise, klinische psychoanalytische Arbeit zu praktizieren, zum Ideal psychoanalytischer Praxis geworden ist?
Die Pandemie des Jahres 2020 veränderte die Art, wie Analytikerinnen und Analytiker üblicherweise ihre Patienten behandeln, radikal und in einer Weise, von der Freud und die meisten von uns sich nie hätten träumen lassen, dass sie über Entfernung hinweg möglich wäre. Analytikerinnen und Analytiker, die lange Zeit an ernster Kritik an der sogenannten „Fernanalyse“ festgehalten hatten und sie als eine Verzerrung von Psychoanalyse ablehnten, waren erstmals gezwungen, ihre Patienten „aus der Ferne“ zu „sehen“. Viele sträubten sich, aber die Mehrheit der Analytiker:innen auf der ganzen Welt sahen sich einer harten Realität gegenüber, als ihre Regierungen einen Lockdown verhängten und uns die Instruktion gaben, zu Hause zu bleiben. Jeder Analytikerin und jeder Analytiker traf die schwierige Entscheidung, entweder online oder am Telefon zu arbeiten oder Patienten weiterhin zu sehen und dabei alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, wie das Tragen einer Maske, Abstand und offene Fenster.
Recht schnell begannen Analytiker:innen, über die neue Situation und über die Spannungen zu schreiben, denen ihre Tätigkeit dadurch ausgesetzt war. Einige hatten bereits mit Patienten im Ausland gearbeitet, sodass dies für sie keine so große Belastung war wie für jene, die es nie für möglich gehalten hatten, analytisch online zu arbeiten ohne die Anwesenheit des Patienten im Raum. In dieser Zeit mussten sich alle Analytikerinnen und Analytiker insofern auf den Patienten verlassen, als dieser Verantwortung für die Einhaltung des Settings übernahm, und jede Analytiker:in explorierte die Thematik einer psychischen Arbeit in der Behandlung eines Patienten, der nicht mit im Raum war. Stellen diese Veränderungen ein Ideal psychoanalytischer Arbeit infrage?
Wenn wir uns zur Außenwelt wenden: wie wenden wir unsere psychoanalytischen Theorien, die auf der Grundlage unserer klinischen Praxis entstehen, dabei an, andere Arten von Pandemien zu verstehen, beispielsweise das Aufkommen des Populismus auf internationaler Ebene? Bereits vor der Covid-19-Pandemie war die Welt Zeuge von Horrorszenarien aufgrund des Klimawandels – neben einem englischen Brexit-Plan, der sich auf die Ideologie gründete, „Kontrolle zurückzugewinnen“. Und diese „Idealisierung“ menschlicher Werte erinnert uns an die deutsche Geschichte und deren dunkles Kapitel der Vorherrschaft einer Nazi-Ideologie, an der die Gefahr sichtbar wurde, dass Idealisierung als Abwehr von unvermeidlichen Enttäuschungen in menschlichen Erfahrungen eingesetzt werden kann. Überidealisierung kann auf diesem Wege leicht zu einer pervertierten Form der Erschaffung sogenannter Ideale werden, die zu destruktiven Prozessen und Ergebnissen führen. Die Ideologie, in welcher der Brexit wurzelt, droht, ein vereintes Europa auseinanderzudividieren, das aus der Asche zweier schrecklicher Weltkriege, die auf europäischem Boden stattgefunden hatten, wiederauferstanden war.
Ein Blick auf unsere zeitgenössische Welt, besonders auf Jugendliche und junge Menschen, zeigt eine Spannung und eine Kluft zwischen einer Suche nach Idealen, einem Fehlen von Idealen und einer fundamentalen Abhängigkeit von Idealen, die zu Ideologiebildungen beitragen. Gründen sich Ideologien auf ein Fehlen von Ressourcen und Gelegenheiten? Vielleicht ist der alarmierende Anstieg des Populismus im Westen ein Hinweis auf die menschliche Tendenz, Unsicherheitsgefühle zu verleugnen, indem man sich auf vereinfachende Ideologien beruft, die eine Scheinsicherheit hervorrufen.
Die Psychoanalyse ist aber nicht frei davon, ihre eigenen Ideologien zu kreieren, die ihre Ursache in historischen Konflikten darüber haben, wie die ideale Theorie und Praxis der Psychoanalyse aussehen. Welches ist der ideale Weg, Psychoanalytiker:innen auszubilden? Wie beurteilen wir idealerweise die künftige Analytikerin und den künftigen Analytiker und wie evaluieren wir kontinuierlich die werdenden Analytiker:innen? Ist es durch die Untersuchung unserer eigenen Trennlinien innerhalb unserer psychoanalytischen Organisationen möglich, die Probleme von Vorurteilen anzugehen, die das Herz der Psychoanalyse zu zerstören drohen? Kann dies eine Lösung zum Verständnis des Aufkommens des Populismus sein? Wie kann die Psychoanalyse die Krankheiten unserer gegenwärtigen Welt behandeln?
Wir freuen uns darauf, Sie nach Wien einzuladen, um diese Fragen und Themen persönlich, wie wir sehr hoffen, auf der 35. Jahreskonferenz der EPF zu diskutieren.